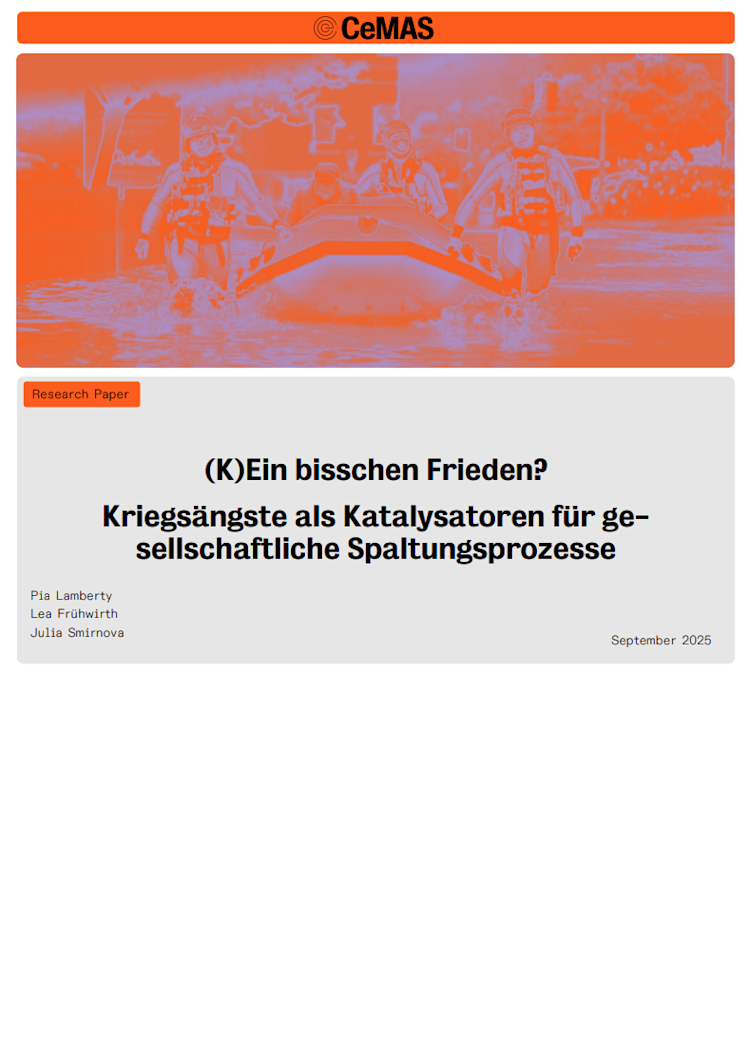Kriege sind längst nicht mehr auf militärische Kampfzonen begrenzt. In einer global vernetzten Welt wirken sie weit in nicht direkt betroffene Gesellschaften hinein, schüren Ängste, beeinflussen politische Einstellungen und verstärken gesellschaftliche Spannungen. In Deutschland zeigen unsere aktuellen Umfragedaten: Die Angst vor Krieg ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen – mit weitreichenden psychosozialen und politischen Konsequenzen.
41 % der Befragten geben an, Angst vor einem Dritten Weltkrieg zu haben. 38 % halten neue Kriege in Europa für wahrscheinlich. 54 % erwarten eine Verschlechterung der sicherheitspolitischen Lage in den nächsten fünf Jahren.
Angst vor Kontrollverlust und Zukunftsunsicherheit sind emotionale Treiber, die die Anfälligkeit für populistische und verschwörungsideologische Narrative erhöhen. Radikale Akteure bieten einfache Schuldzuweisungen, klare Identitäten und scheinbare Handlungsfähigkeit – gerade in Phasen der Unsicherheit.
Kriege lösen eine Vielzahl intensiver Emotionen aus – von Ohnmacht und Angst bis hin zu Wut und Hilflosigkeit. Diese Reaktionen erleben nicht nur direkt Betroffene in Kriegsgebieten, sondern auch jene, die sich „nur“ über Medien mit dem Kriegsgeschehen oder potenziellen Bedrohungsszenarien auseinandersetzen. Bereits die abstrakte Angst vor einem Krieg kann zu einer mentalen Belastung werden. Propaganda und die Angst vor Krieg sind außerdem ein Nährboden für autoritäre Kräfte.